Busenbeben alias Boobquake: Erdbeben wegen unzüchtiger Kleidung bei Frauen!
Als „liberale, dämliche, doofe, wissenschaftliche, pervertierte, femministische Atheistin“ aus Indiana kann Jen McCreight eine ordentliche Präsenz im Web aufweisen, die durch ihre neueste Aktion wohl noch dazugewinnen wird: Im Namen der Wissenschaft opponiert sie gegen die Meinung des iranischen Klerikers Hojatoleslam Kazem Sedighi, der in der leichten Bekleidung vieler vor allem junger iranischer Frauen einen Hauptgrund für Erdbeben sieht. Diese Frauen würden junge Männer in die Irre führen, ihre Keuschheit korrumpieren und der Verbreitung von Ehebruch in der Iranischen Gesellschaft Vorschub leisten. Somit steige auch die Erdbebenhäufigkeit.
Dieser massiven logischen Kette will Jen nun mit nackten Tatsachen begegnen und den Gegenbeweis antreten. Auf der Facebook-Gruppe Boobquake möchte sie möglichst viele Frauen dazu animieren, am Montag den 26. April 2010 mit gezielter Kleidungswahl bewusst unzüchtig zu sein und ein Erdbeben auszulösen, oder eben nicht. Der überwältigende Erfolg von bislang über 30.000 Gästen und zahlreichen Tweets zum Hashtag #boobquake auf Twitter lässt die Dame dann doch etwas zurückrudern, auf die Ergebnisse darf man aber trotzdem gespannt sein.
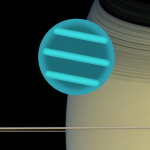











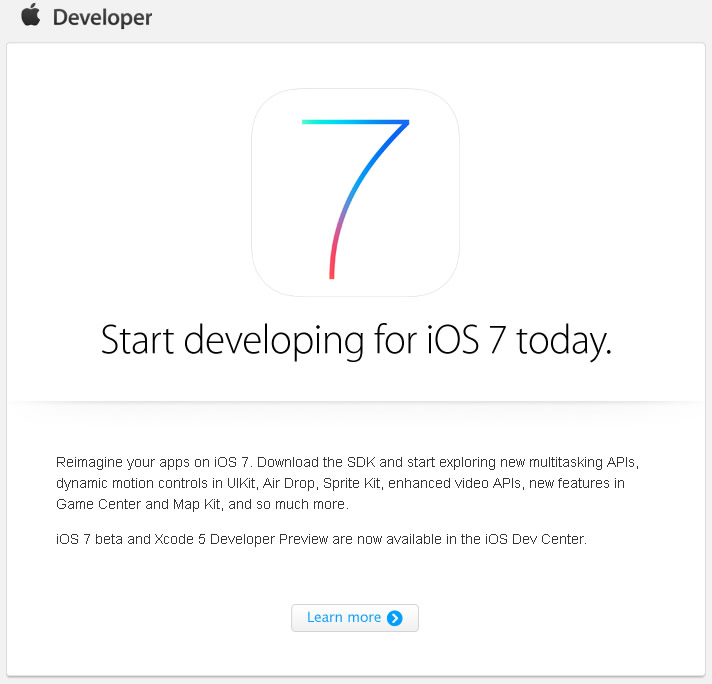
Get Social