Wackelt die Standardtheorie der Kosmologie?
Pavel Kroupa und Manuel Metz vom Argelander Institut für Astronomie der Universität Bonn, Gerhard Hensler und Christian Theis vom Institut für Astronomie der Universität Wien sowie Helmut Jerjen von der Research School of Astronomy and Astrophysics der Nationaluniversität Australiens in Canberra könnten das Gebäude der kosmologischen Standardtheorie zum Wackeln bringen: 2 neue Studien (Metz et al.: Did the Milky Way dwarf satellites enter the halo as a group? The Astrophysical Journal 2009, Metz et al.: Discs of Satellites: the new dwarf spheroidals. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2009) untersuchen die sogenannten Satellitengalaxien der Milchstraße, die gemäß Standardtheorie als Zwerggalaxien mit teilweise nur ein paar tausend Sternen zu Hunderten in der Umgebung der meisten großen Galaxien vorkommen sollten.
Die neuen Befunde zeigen dreierlei:
Die Verteilung der Sternagglomerate stimmt nicht mit der Vorhersage überein, anstatt einer gleichförmigen Anordnung um die Muttergalaxie liegen sie in einer Scheibe.
Die meisten Satelliten rotieren in derselben Richtung um die Milchstraße. Dieser Befund lässt sich nach den Autoren nur durch ein Enstehen bei einer Kollision junger Galaxien vor langer Zeit erklären.
Die Sterne in den Satelliten bewegen sich viel schneller, als es ihnen den Berechnungen nach vergönnt ist.
Hier nun sollte eigentlich die Standardausrede „Dunkle Materie“ in Spiel kommen, die sich aber verbietet, wenn die Satelliten im obigen Crash-Szenario entstanden sind.
Also würde die aktuelle Studie als Stütze für die “modifizierte Newtonsche Dynamik” (MOND) durchgehen, die in Bereichen von Galaxien extrem schwacher Beschleunigung herrschen könnte.
Ob hier der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird, sollte die Zukunft zeigen.
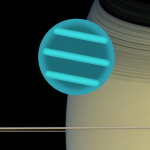











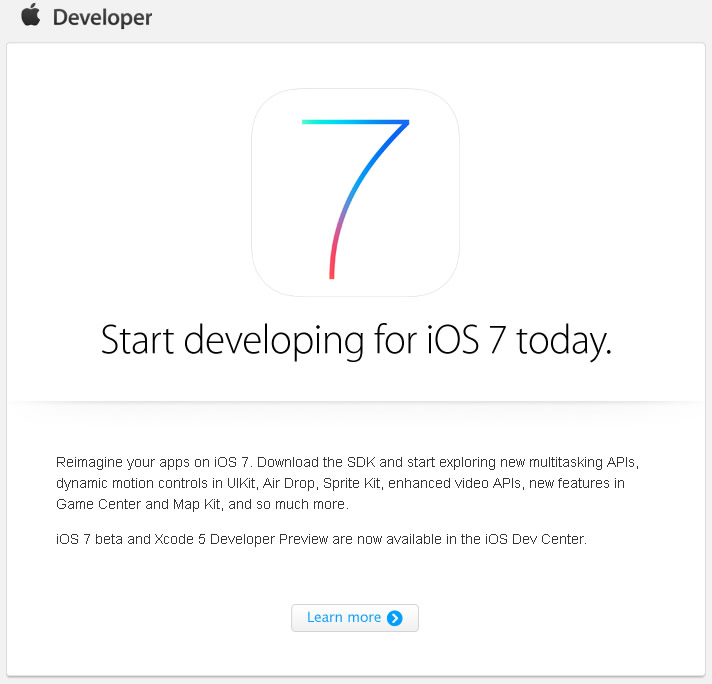
Get Social